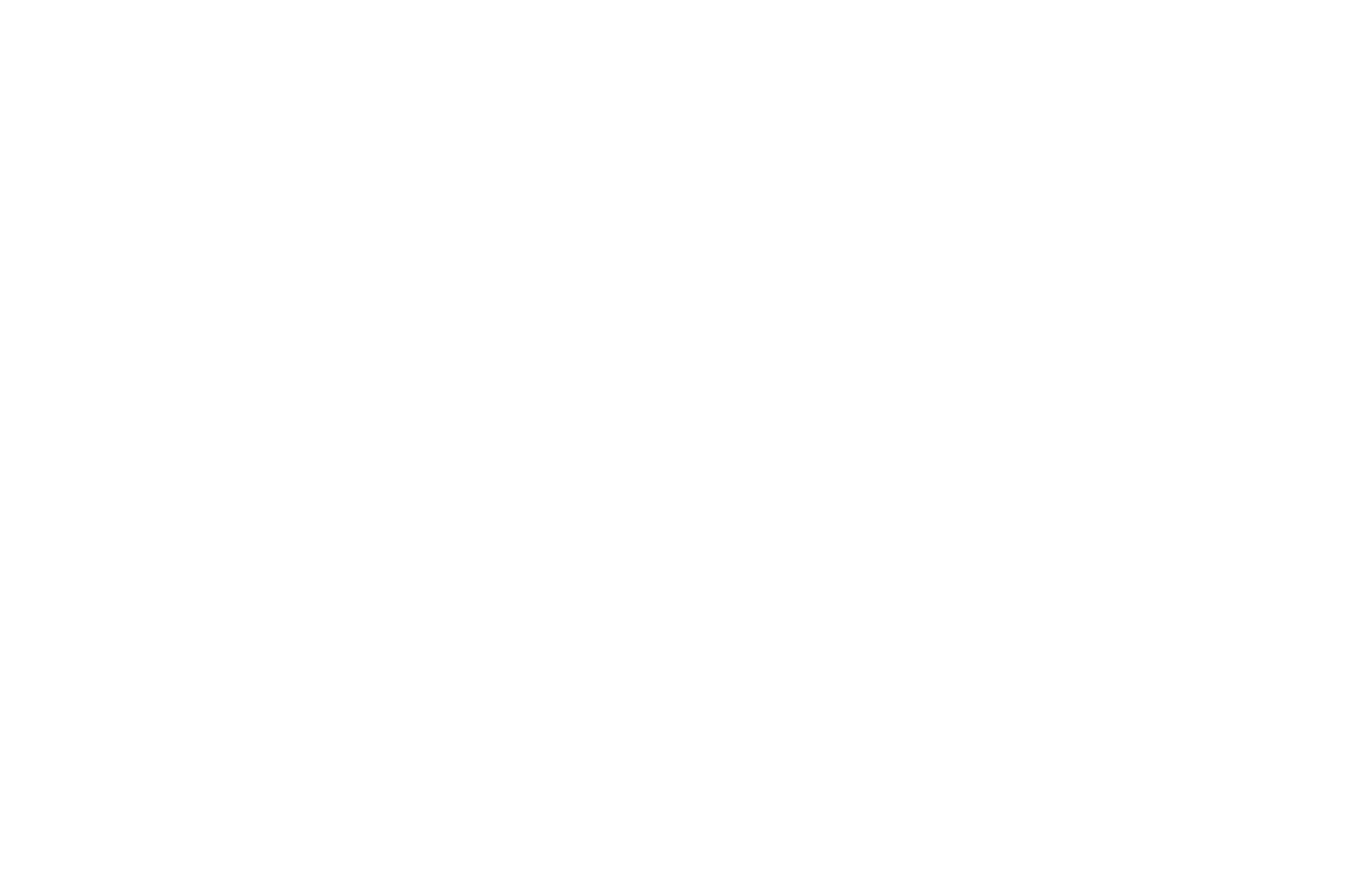Revision des Obligationenrechts vom 01.01.2026
Die anstehende Revision von ZGB und OR bringt zentrale Änderungen zur Verjährung, Verwirkung und zum Bauhandwerkerpfandrecht, mit dem Ziel, Bauherren und Käufer besser vor Rechtsnachteilen durch kurze Fristen und unfaire Vertragsklauseln zu schützen.
Kurzübersicht der Revision:
Art. 367 Abs. 1 nOR und Art. 370 Abs. 3 nOR: Gesetzliche Verlängerung der Rügefristen bei unbeweglichen Werken und bei versteckten Mängeln
Art. 368 Abs. 2bis nOR: Zwingendes Nachbesserungsrecht: Ein Recht auf unentgeltliche Nachbesserung
Art. 371 Abs. 3 nOR: Verjährungsschutz: Neue teilzwingende Regel betreffend Verjährungsfrist
Art. 219a Abs. 1 nOR: Möglichkeit der Nachbesserung auch bei einem Grundstückkauf
Art. 839 Abs. 1 nZGB: Beschränkung der Sicherheitsleistung betreffend Verzugszinsen von Bauhandwerkerpfandrechten (als Abwehr gegen Bauhandwerkerpfandrechte)
Problemstellung:
Die bisherige Rechtslage und Rechtsprechung zum Thema Mängelrüge bei Kauf- und Werkverträgen stellte für private-, gewerbliche- und professionelle Bauherren eine erhebliche Herausforderung dar. Nach der Ablieferung eines Werks bzw. der Kaufsache mussten die Mängel sofort gerügt werden, was nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedeutete, dass dies innert sieben Tagen erfolgen musste. Diese Frist ist nicht nur sehr kurz, sondern im Zusammenhang mit Unsicherheiten betreffend Mängel oder Unkenntnis von der Rechtslage, praktisch unmöglich einzuhalten.
Insbesondere bei versteckten Mängeln, deren Tragweite sich nur schleichend zeigt, ist die sofortige Rügeobliegenheit bzw. Rügepflicht unverhältnismässig.
Nach Erkennbarkeit des Mangels läuft die Frist ohne Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad der Beurteilung, wobei die Mängelrüge entsprechend substantiiert, formgerecht und fristgerecht erfolgen muss.
Die Revision im Einzelnen:
(A) Verlängerung der Rügefristen (Art. 367 Abs. 1 nOR und Art. 370 Abs. 2 nOR)
Die bisherige bundesgerichtliche Rügefrist wird für unbewegliche Werke und für den Grundstückkauf mit neu 60 Tagen gesetzlich verankert bzw. verlängert (Art. 367 Abs. 1 nOR und Art. 219a Abs. 1 nOR). Diese Frist gilt auch für die versteckten Mängel (Art. 370 Abs. 3 nOR). Eine solche Verlängerung ermöglicht realistischere Reaktionszeiten für den Bauherrn und reduziert die Gefahr, Mängelrechte durch Fristversäumnis zu verlieren. Zu beachten ist jedoch, dass der Bauherr Schäden weiterhin selbst zu tragen hat, die bei unverzüglicher Behebung des entdeckten Mangels hätte vermieden werden können.
(B) Unabdingbares Recht auf Nachbesserung (Art. 368 Abs. 2bis nOR)
Bisher konnten Mängelrechte in Verträgen teilweise Wegbedungen werden, wobei im Gegenzug das Unternehmen oder der Verkäufer oft seine Mängelrechte (z.B. gegenüber Subunternehmer) dem Bauherrn oder Käufers abtraten. Dies führte zu einer erheblichen Schwächung des Bauherrn bzw. des Käufers. Die Gesetzesänderung sieht in Art. 368 Abs. 2bis nOR vor, dass diese Abmachungen unwirksam werden, soweit es um das Recht auf unentgeltliche Nachbesserung bei Mängeln an Bauten geht. Dieses Recht wird damit zwingend und unabdingbar. Das Ziel der Revision liegt darin, die Stellung von Bauherren gegenüber General- oder Subunternehmen zu stärken.
(C) Unabdingbares Recht auf Nachbesserung (Art. 371 Abs. 3 nOR)
Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängel an Bauwerken beträgt weiterhin fünf Jahre, jedoch ist die Frist neu teilzwingend und Abweichungen zum Nachteil von Besteller oder Bauherren sind i.S.v. Art. 371 Abs. 3 nOR unzulässig.
(D) Nachbesserungsrecht beim Grundstückskauf (Art. 219a nOR)
Neu erhält auch der Käufer von Grundstücken mit einer neu errichteten Baute (oder innert der letzten zwei Jahre errichteten Baute) ein zwingendes Nachbesserungsrecht (Art. 219a nOR). Dementsprechend ist ein allfälliges Nachbesserungsrecht nicht mehr vom Zufall abhängig, ob der Vertrag als Werk- oder Kaufvertrag qualifiziert wird. Die Änderung führt dazu, dass bei einem Kaufvertrag und Werkvertrag in diesem Zusammenhang dem Bauherrn / Käufer dasselbe Recht zusteht, unabhängig davon, ob es als Werk- oder Kaufvertrag qualifiziert wird.
(E) Änderung der «hinreichenden Sicherheit» bei Bauhandwerkerpfandrechten (Art. 839 nZGB)
Unternehmer haben die Möglichkeit, bei der Nichtbezahlung ihrer Forderungen ein sog. Bauhandwerkerpfandrecht eintragen zu lassen. Bei der Nichtbezahlung des Werklohns ist es unerheblich, ob die Forderungen durch den Bauherrn selbst- oder durch den Generalunternehmer nicht bezahlt wurden. Die Bauherren tragen dabei das Risiko, dass der Generalunternehmer die Subunternehmer (nicht) fristgemäss bezahlt. In solchen Fällen kann das Grundstück mit einem Bauhandwerkerpfandrecht belastet werden, obwohl der Generalunternehmer fristgerecht vom Bauherrn bezahlt wurde. Es besteht das sog. Doppelzahlungsrisiko. Das Gesetz sieht dazu vor, dass ein Eigentümer eine hinreichende Sicherung erbringen kann, um so das Pfandrecht abzuwenden. Dabei gehören unbestrittenermassen auch die Verzugszinsen dazu. Dies macht aber die Realsicherheit (Hinterlegung des Geldbetrags) unmöglich, da die Verzugszinsen nicht zum Voraus berechnet werden konnten. Neu sieht deswegen Art. 839 Abs. 1 nZGB vor, dass die Sicherung der Verzugszinsen auf 10 Jahre beschränkt wird, was nun dazu führt, dass eine Kapitalisierung erst überhaupt möglich wird.
Fazit
Die Revision des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts bringen lang erwartet Verbesserungen für die Bauherrn und Erwerber. Durch die verlängerten (gesetzlichen) Fristen, zwingenden Nachbesserungsrechten und klarere Regelungen zum Bauhandwerkerpfandrecht wird die Rechtssicherheit verbessert und die Durchsetzung von Mängelrechten erheblich erleichtert.